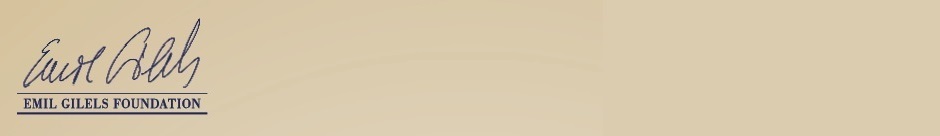Joachim Kaiser: Große Pianist unserer Zeit
Aus dem Buch “Große Pianisten unserer Zeit”
Der Pianist Emil Gilels hat im Oktober 1961 in Moskau einen öffentlichen Klavierabend gegeben, der – mit sämtlichen Hustern, mit Beifallsbekundungen und auch den gelegentlichen ganz unbeträchtlichen Fehlern, die Gilels da unterliefen – auf zwei Schallplatten »gebannt« worden ist. Diese beiden Platten gehören nicht nur zum Besten, was ich von Gilels kenne, sondern sie offenbaren eine Meisterschaft, die auf der ganzen Welt kaum mehr als drei Virtuosen im Konzert darbieten könnten – hin und wieder spielt Gilels da (im ganzen gesehen) zwingender als selbst ein Rubinstein oder ein Horowitz. Auf Grund dieser Platten, die Schumanns fis-Moll-Sonate, Chopins Trauermarsch-Sonate, Liszts h-Moll-Sonate großartig enthalten, dazu noch Kleinigkeiten von Bach/Siloti, Strawinsky und Ravel, darf man den Schluß wagen, daß Gilels doch zu bescheiden ist, wenn er immer wieder behauptet, Swjatoslaw Richter spiele weit besser als er. Die beiden sind, zumindest, gleichwertig, wenn auch nicht gleichartig.
Zu Gilels Charme, seiner Vitalität, Gesundheit und seiner Pranke ist noch eine intellektuelle Überlegenheit, eine motorische und dramatische Modernität gekommen, die ihn wohl doch zum ersten Pianisten Rußlands macht. An diesem Oktoberabend des Jahres 1961 begann Gilels mit Schumanns fis-Moll-Sonate. Dieselbe Sonate aber hatte er einige Jahre zuvor auf Schallplatten eingespielt. Die beiden Gilels-Platten des Klavierabends sind in Rußland unter der Nummer 011278-112 79 a erschienen – die Soloplatte mit der fis-Moll-Sonate wurde eigens für die Brüsseler Weltausstellung von 1958, also drei Jahre vorher, geprägt. Sie hat die Nummer D 4080-4081. Man kann also vergleichen, wie ein und derselbe Künstler dasselbe Stück auf Platten und im Konzert spielt. Die Unterschiede sind musikalisch und psychologisch faßbar- und sie sind erstaunlich.
Zunächst beginnt die Platte mit einer günstigen Vorgabe. Der Künstler ist natürlich nicht so nervös, muß sich nicht akklimatisieren, darum nimmt er die langsame Einleitung breit und mächtig, wie sie wahrscheinlich von Schumann gemeint ist. Im Konzert ist Gilels befangener und etwas flüchtiger. Da spielt er denselben Anfang um vieles rascher, als habe er Angst, sonst das Publikum nicht in den Griff zu bekommen.
Natürlich spürt Gilels, der im Konzert Schumanns fis-Moll-Sonate so viel rascher begann, als es seine Schallplattenauffassung war, daß er in Gefahr gerät, den Gegensatz zwischen »langsam« und »schnell« zu verwischen. Er spürt es entweder bewußt oder, weil er ein Künstler mitten im Konzert ist, wo er ja nicht einfach noch einmal anfangen und lange Überlegungen verifizieren darf, instinktiv. So kann man beim Konzertmitschnitt konkret miterleben, wie der große Gilels sich bemüht, durch um so innigeren Ausdruck gewissermaßen die Flüchtigkeit des Beginns aufzufangen. Schon die Spannung, mit der er dann das Allegro artikuliert, ist stärker als auf der Platte, wo alles seinen geregelten, schönen Lauf nimmt. Und wenn dann in dieses Allegro langsame Partien hineindämmern, dann spielt Gilels im Konzert ungleich beredter, engagierter als auf der Platte. So wie ein Mensch, der mit aller Anstrengung seines Sensoriums und seiner Leidenschaft ein begonnenes Abenteuer zu Ende bringen will, der die »Einmaligkeit« des öffentlichen Konzerts in allen Fasern spürt. So kommt es, daß am Schluß des ersten Satzes nicht nur alle Nervosität längst abgefallen ist. Sondern in der Fülle und dem Glücksgefühl, Schumann doch noch ganz gerecht geworden zu sein, das Publikum ganz in den Bann geschlagen zu haben, wächst Gilels da über sich hinaus. Am Schluß des ersten Satzes gelingt ihm ein überwältigendes »piu lento«. Da ist er nun plötzlich im öffentlichen Konzert bemerkenswert langsamer als auf der ausgeglicheneren Platte.
Diese unbeschreiblich reine Eingebung Schumanns trifft Gilels bei der Studioaufnahme nicht annähernd so spontan, so phantasievoll, so gelöst und selig überredend. Auf der Platte, die er einige Jahre vor dem Konzert aufgenommen hat, klingt dieselbe Stelle selbstsicherer, weniger bewegend. Schön, gewiß -aber doch nicht so eindringlich, hingebungsvoll mit Leib und Seele gespielt.
Das Gefühl spreche eben im Konzert unter glücklichen Umständen vielleicht freier, werden die Befürworter der Schallplatte sagen, dafür falle aber bei der Studioaufnahme die Unsicherheit des Konzertzufalls weg, und der Künstler könne Passagen, die im Konzert ein Kampf mit der Tücke des Objekts sind, auf ihre rein musikalische Substanz hin ausspielen. Doch auch das ist fraglich. Hört man dies Scherzo im Konzertmitschnitt, dann scheint ein Entfesselter, ein genialer Virtuose am Flügel zu sitzen. Gilels wagt da ein viel rascheres Tempo als bei der Studioaufnahme! Man merkt: er will alles riskieren. Zwei Unsauberkeiten stören ihn nicht und uns nicht. Das Schumann-Scherzo, eben noch ein hübsches, kapriziös romantisches Klavierstück, wird zur hinreißenden Bekundung eines feurigen Lebensgefühls. Glasklar die Linke, die Akkorde der Rechten fallen wie Blitze, der Unterschied zwischen Konzertfeuer und Schallplattenruhe scheint astronomisch.
Bei diesem Vergleich zwischen Konzertmitschnitt und Schallplatteneinspielung wollen wir nicht übersehen, dass Gilels natürlich im Jahre 1961, in dem er übrigens auch seine Deutschlandtournee machte und Mozarts großes C-Dur-Konzert wie Tschaikowskis b-Moll-Konzert unvergeßlich interpretierte, als Pianist und Künstler möglicherweise weiter und reifer war als zur Zeit, da er die Schallplattenaufnahme derselben Fis-Moll-Sonate einspielte. Doch darauf kommt es gar nicht so sehr an. Sondern der Reiz der Konzertaufnahme, wofür es kaum ein anderes Wort als das längst blaß gewordene »lebendig« gibt, liegt vor allem in der Reaktion des Künstlers sowohl auf das Gesetz, nach dem er angetreten, als auch auf das Publikum und die gewonnene Aufmerksamkeit. Nur diese Reaktion, dieser unbegriffliche Ganzheitsbegriff, wiederum läßt jene Spontaneität entstehen, die lauter einzelnen Punkten, mögen sie noch so gut dargeboten sein, kaum jemals innewohnen kann.
Emil Gilels, Jahrgang 1916, Bruder einer Geigerin, mit Leonid Kogan verschwägert, mit einer Komponistin verheiratet, stammt aus einer russischen Musikerfamilie. Er verkörpert rein den kräftigen russischen Virtuosentypus. Da ist noch die offenkundige Beziehung zu den spätromantischen, aufs Grandiose und Virtuose bedachten Klaviertitanen der Liszt- und Siloti-Schule.
Selbst die jüngeren russischen Virtuosen spielen nicht »modern«, wie ein Friedrich Gulda oder ein Glenn Gould es zu tun versuchen. Freilich sind sie auch nicht unschuldig altmodisch. Sie haben die exzentrische und ironische Welt eines Prokofjew hinter sich. Grandezza, dividiert durch Prokofjews Phantastik und pianistischen Charme: das wäre also eine Formel für die Voraussetzungen von Gilels. Während Horowitz virtuose Zerrissenheit manche Werke so fesselnd durchdringt, daß seine maßlose Klavierkunst gleichsam zur interpretatorischen Wünschelrute wird, forciert Gilels immer nur höchstens das Tempo -aber selten die Nerven. Er ist ein gesunder Pianist, kein manierierter.
Das Wort »gesund« klingt neuerdings ein wenig verächtlich. Ist kein reines Lob mehr wie zur Goethezeit. Fast immer assoziiert man Undifferenziertheit, mangelnde Passion, seelische Armut, wenn es heißt, ein Künstler sei gesund. Um auch den letzten Rest solcher Assoziationen zu tilgen, sei hinzugefügt, daß Gilels nicht nur seinen Anschlag- er ist der einzige Lebende, der sich da mit Rubinstein messen kann -, sondern auch seine »harmonischen« Interpretationen offensichtlich mühsam erkämpft. Wenn man ihm beim Spiel zuschaut, dann wirkt dieser Pianist immer zerfurchter und gepeinigter, als sein Spiel klingt.
Für die durchtrainierte Hand, den Charme und die Frische seines Spiels sprechen Gilels Scarlatti-Interpretationen. Da herrschen zupackende Klarheit, prangende Helle, eine musterhafte Genauigkeit und Präzision des Griffs. Die Akkorde des Hauptthemas der C-Dur-Sonate – Puccini-Liebhaber dürften heraushören, woher die Quintenpartien der »Boheme« kommen, und Puccini würde gewiß nichts dagegen haben, so buchstäblich mit der italienischen Tradition in Zusammenhang gebracht zu werden – nimmt Gilels ohne jede historisierende Scheu und Langeweile. Man darf an ein vergnügt mit seinen Tatzen spielendes Raubtier denken, wenn man ihm dabei zuhört. Im zweiten Teil wirds eine Spur melancholisch. Aber Gilels, von der glanzvollen Verve seines Spiels fortgerissen, forciert die melancholische Nuance keineswegs, er stellt nicht die Urlaute russischer Seele dar, sondern nur eine pianistische Kostbarkeit. Darum untertreibt er sogar ein wenig. Das Ganze dauert nur 100 Sekunden; aber viele klavierverliebte Erdenbürger müßten 100 Jahre üben, bis sie es dann doch nicht ganz so gut könnten wie dieser Emil Gilels.
Doch auch dieser phantastische Pianist hat Grenzen – und es ist gewiß kein Zufall, daß diese Grenzen am meisten zutage treten, wenn er Beethoven oder eine Mozart-Sonate oder Brahms B-Dur-Konzert bewältigen will. Wenn der »frühe« Gilels einer frühen Beethoven-Sonate begegnet, nämlich der mit durchaus virtuosem Anspruch komponierten C-Dur-Sonate op. 2,3, dann hilft der Charme nicht. Das rokokohafte, eigentlich kinderleichte Seitenthema schwingt nicht aus, die natürlich makellos dargebotenen Passagen und Akkorde kommen zu gestochen, zu explosiv, zu sehr, als wüßten sie schon von Tschaikowski. Es fehlt der Musik die Innenspannung: Man spürt, wie alles von außen, mit pianistischer Kunst und virtuosem Temperament, hinzugetragen wird, aber die Musik lebt nicht aus sich selbst, atmet nicht. Das donnert nur, verrät naive Freude am Können, ist feurig. Doch der frühe Gilels schien dem frühen Beethoven nicht gewachsen. Er überfuhr ihn – und war selber das Opfer.
Manche russischen Pianisten pflegen einen allzu motorischen, allzu kindlichen Mozart. Sie haben Angst, Mozart spätromantisch zu verzerren und zu verdicken – darum legen sie sich (und Mozart!) zuchtvolle Beschränkung, eine Art »Stildiät« auf: verlassen sich aufs bloß perlende Spiel und auf sanften Ausdruck. Sie »dissimulieren«, sie stellen sich kühl. Wenn Horowitz Mozart spielt, kann man – etwa im ersten Satz der großen F-Dur-Sonate KV 332 – Spuren dieses Dissimulierens entdecken; manchmal wird dann allerdings die gekünstelte Verstellung beendet, und ein überhartes Forte bricht durch. Auch Gilels scheint Mozart früher vor allem als Schule der Geläufigkeit empfunden zu haben. Darüber ist er längst hinaus. Gilels hat sich, das belegt seine Interpretation des großen C-Dur-Konzertes KV467, Mozarts Ausdruck entdeckt. Gelegentlich gibt es zwar rhythmische Schwankungen; aber der Ton leuchtet, ist kantabel und von bewunderungswürdigem Gleichmaß, die Passagen haben Leben und wagen konzertanten Schwung. Mozart, unter Gilels Händen, wird zum pianistischen Ereignis. Die Intimität von Mozarts kleiner d-Moll-Fantasie liegt Gilels nicht so gut – da forciert er die Gegensätze. Aber das ohnehin verhältnismäßig extrovertierte »große« C-Dur-Konzert spielt er mit beherrschter Hingabe: Erst bei der Kadenz merkt der überraschte Hörer, welche Stilbrüche der Pianist während des Stückes klug vermieden hat. Deutsche und französische Pianisten bevorzugen heute einen mehr gezeichneten, mehr gläsernen Mozart. Gilels spielt das Konzert in großer, nächtlich-dunkler, festlicher Manier: farbig und innig wie Rubinstein. Er zerrt Mozart keineswegs in verbotene Chopin-Bezirke, sondern bietet ein Exempel großen, künstlerisch durchaus vertretbaren und pianistisch hinreißenden Klavierspiels.
Gilels empfindsamer Konzert-Mozart scheint mehr an den Forte- als an den Pianostellen gefährdet. Bereits Gilels Mozart enthält nämlich – ebenso wie seine hinreißend pointierte Darbietung des D-Dur-Konzerts von Haydn – die unnachahmliche, typische Grundspannung aller Gilels-Interpretationen: den Gegensatz zwischen einem lächelnden, charmanten, innigen und persönlichen pianistischen Augenaufschlag einerseits und prasselnder Bravour andererseits. Freilich, die frühen Klaviersonaten spielt er neuerdings doch wieder zu sicher, zu glatt; wenn er jedoch etwa im kaum mehr bekannten, sehr virtuosen zweiten Klavierkonzert von Saint-Saens das Scherzo meistert, dann hat da die überschäumende Lust am Leichten, an der Grazie, eine Humanisierung des Motorischen zur Folge. Gilels spielt das sehr salonhafte Seitenthema ohne jede Trivialität mit kantabler Behutsamkeit. Schöner kann kein Flügel klingen (Beispiel 14).
Gilels antwortet auch im dritten Rachmaninow-Konzert nicht nur souverän, sondern charmant. Er ist einer der glänzendsten Virtuosen unserer Epoche, er verleiht den »Reißern« Noblesse. Er ist kein Getriebener wie Horowitz, dessen Wildheit die Stücke manchmal Überspannt, vergewaltigt, fesselnder und bedeutender macht, als sie wirklich sind – wie man es überwältigt hören kann, wenn Horowitz etwa im Finale des dritten Rachmaninow-Konzerts eine Ekstase türmt, so daß Rachmaninow selbst zu den erschreckten Bewunderern des jungen, teuflisch begabten Horowitz gehörte. Gilels ist ausgeglichener. Seine Virtuosität will die schöne, vollkommene Darstellung der romantischen Literatur; aber sie wird nicht zur musikalischen Wünschelrute, zur unnachgiebigen Atomspaltung wie bei Horowitz. Dafür bleibt Gilels Spiel auch ohne jenen exzentrischen Drücker, ohne jenen verzweifelten, immer das Äußerste anstrebenden Kampf, der die Horowitz-Interpretationen so aufregend und manchmal abwegig werden läßt. Selbst wenn Gilels einen ironisch pointierten, glänzenden Prokofjew spielt, sprengt er weder die Grenzen des Klaviers noch des Geschmacks.
Mittlerweile hat Gilels sich auch ums 18. Jahrhundert (Scarlatti, Bach und Bach-Söhne) gekümmert, er hat mit George Szell und dem Cleveland Orchestra für Angel Records die fünf Beethoven-Konzerte eingespielt; dazu noch drei Variationszyklen. Bereits diese Platten lassen einen neuen Gilels erkennen: zurückhaltend, harmonisierend, auf Ausgleich und Stiltreue bedacht. Bei aller Bewunderung hört man die Aufnahmen ein wenig enttäuscht: Es fehlt ihnen an Spontaneität, an Gewalt. Sie haben etwas Meisterhaftes auch im negativen Sinn, sind perfekt und akademisch. Weit weg scheint jener Gilels, der Schuberts f-Moll-Impromptu op. 142,1 in einen traurigen Traum, Liszts h-Moll-Sonate in einen festlichen Sturm zu verwandeln wußte.
Gilels geht nicht mit einer »Auffassung« an die Werke heran, sondern mit seinen Fingern, mit den Möglichkeiten und Verheißungen des Steinway-Flügels. Unter den Händen eines solchen Pianisten kann die Mischung aus Technik, Klangsinn, virtuoser Versenkung in »Interpretation« umschlagen. Ein feinsinniger Technokrat wird zum Entdecker. So erspürte Gilels im ersten Satz von Webers As-Dur-Sonate – dank seines überwältigenden Legatos – die Naturmystik, das pulsierende, herrliche Freischütz-Geheimnis. Der Zwiespalt zwischen dem »deutschen« Opernkomponisten und dem internationalen Klaviervirtuosen Weber existiert dann nicht mehr. Den ersten Satz spielt er zurückhaltend, verträumt, vielleicht sogar um eine Spur zu verhalten. Merkwürdigerweise bleibt das Finale etwas starr: Bei Gilels stellt sich im Konzert manchmal keine überzeugende Verbindung zwischen Verhaltenheit und Gedonner her.
Die c-Moll-Variationen Beethovens, jenes ganz streng durchgeformte, alle Möglichkeiten des Figuralen ausnutzende, im Gegensatz zu den Diabelli-Variationen aber eher rückwärts gewandte Werk interpretiert er mustergültig. Alle Tonwiederholungen artikuliert er logisch und klar. Großes Klavierspiel. Das ist gewiß keine leere Virtuosität, aber doch nur eine Interpretation aus dem Geist des Instrumentes. Da, wo der Interpret sein Wort sagen, wo das Subjekt sprechen, eingreifen könnte, müßte – in der leichten fugierten »minore«-Variation, in den Abgründen der 30. oder vor allem in der sechsmal wiederholten, zwielichtig brütenden Kadenzwendung vor dem Schluß -, bei Gilels bleibt es immer nur beherrschtes, schönes, klares Klavierspiel. An Elegischem fehlt es nicht, an Strenge nicht, aber an der großen, nervösen, leise-gewaltigen Spannung.
Es ist nicht respektlos gemeint, wenn das Phänomen Gilels hier mit einer Präzisionsmaschine verglichen wird. Er scheint immer im Besitz neuer, überraschender Energien, wenn die Schwierigkeiten sich steigern. Bei Steigerungen, die anderen Mühe machen, so daß man diese Mühe auch merkt und gleichsam der Interpretation zuschlägt, setzt er, scheinbar mühelos, neue, anderswo herkommende Kräfte ein. Beethoven-Interpret ist er dann nur im Piano, im Fortissimo erwacht das Prokofjew-Feuer. Auch seine jüngste Einspielung der frühen Mozartschen Klaviersonaten leidet ein wenig an dieser pianistisch perfekten Unfreiheit. Einst klang Gilels Mozart schöner, tiefsinniger, weniger irdisch, mehr himmlisch.
Die Romantiker liegen ihm mehr. Gilels Einspielung vor allem der Nachtstücke op. 23 von Schumann und der Moments musicaux op. 94 von Schubert ist von erlauchter Kultur. Sätze wie: »Schönste Klavierplatte seit langer Zeit« oder »Beispiel meisterhafter Verinnerlichung«, die man kaum hinzuschreiben wagt, weil sie unfehlbar als Werbebumerang wiederkehren, vermögen, eben weil sie als Werbefloskel ja längst nicht mehr ernst genommen werden, keineswegs auszudrücken, was Gilels da gelang.
Daß Gilels einer der größten Pianisten der Erde ist, wenn nicht im Augenblick sogar der bedeutendste, wird von vielen Fachleuten angenommen. Gewiß, ich habe den Künstler auch schon überaus nervös und fehlbar und tournee-erschöpft gehört. Da bietet diese Gilelssche Schumann-Einspielung Trost. Was an ihr besticht, ist zunächst der Ton an sich. Selten wurde – und gar auf den technisch meist recht unterentwickelten UdSSR-Aufnahmen – der Klang eines schönen, nicht allzu obertonreichen, keineswegs scharfen, sondern wohllautenden dunklen und intimen Konzertflügels so rein und reich auf eine Platte transponiert.
Schumanns Nachtstücke schließen die Reihe der genialen Klavierkompositionen zwischen Opus 1 und Opus 23 ab, mit denen der junge, leidenschaftlich antiakademische Künstler sich der Klavierwelt vorstellte und ihr neue, ebenso kühne wie träumerische Ausdrucksbezirke gewann. Die Nachtstücke gelten als relativ »schwach«, selbst der Plattentaschentext gibt das »gramvoll ehrlich veranlagt« (wie Thomas Manns Dichter Detlev Spinell sagen würde) zu. Gilels aber straft die Skepsis Lügen.
Obwohl die Stücke relativ leicht sind, geht sein eminentes Können gleichsam als grifftechnischer Überschuß in die Interpretationen ein. Die rhythmisch gespannte Ruhe, mit der Gilels das erste Nachtstück steigert, die phantastische Unruhe, die er im zweiten erzeugt, der überwältigende Geschmack, mit dem er das großartige dritte Stück eben nicht in jene Rachmaninow-Nähe spielt, die sich ergeben würde, wenn der Pianist allzu brillant aus sich herausginge, das verhaltene, um so glühendere Feuer, das sich da als Anschlagsdiskretion ausdrückt: Reineres kann Klavierspiel kaum leisten. Und die volksliedhafte Lyrik des vierten Nachtstückes spielt Gilels geradezu unvergleichlich konzentriert und melodisch aus.
München 1972